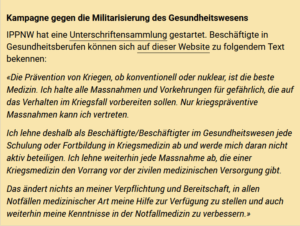Deutschland sei «Aufmarschland» geworden, lernen die dortigen Ärzte. Die Nato rechnet mit 500 bis 2000 verletzten Soldaten täglich.
Martina Frei für die Online-Zeitung INFOsperber
Das US-Verteidigungsministerium soll neu «Kriegsministerium» heißen. «Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein», forderte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im Juni 2024. Er sagte «kriegstüchtig» anstelle von «verteidigungsfähig» – und benützte damit ein Wort, das 1944 schon der Nationalsozialist Joseph Goebbels und die Nationalsozialistische Wochenzeitung «Das Reich» verwendet hatten. Darauf wies ein Artikel in der Zeitschrift «Wissenschaft und Frieden» hin, der sich kritisch mit der «schleichenden Militarisierung der Medizin» auseinandersetzt.
«Kriegstüchtig» – das bedeutet, dass täglich circa 500 bis 1000 verletzte «Soldaten nach Deutschland zurückkommen, um in unseren Krankenhäusern versorgt zu werden». Die Nato gehe davon aus, dass die Hälfte davon intubiert und beatmet eintreffen würde, informierte ein Artikel in der Verbandszeitschrift des «Berufsverbands der Deutschen Chirurgie» die Mitglieder.
Bundeswehrspitäler innert Tagen ausgelastet
Angesichts von 1850 Betten in Bundeswehrspitälern sei klar, dass «ein ganz wesentlicher Teil» der Verletzten in zivilen Spitälern versorgt werden müssten. Deutschland sei «Aufmarschland geworden» und würde im Ernstfall zur «Drehscheibe». Das Land müsste «für circa 800’000 Soldaten die medizinische und damit auch chirurgische Versorgung übernehmen».
Da «natürlich ein Großteil der Chirurgen beim Landesverteidigungs- /Bundesverteidigungs-Szenario nicht in den Bundeswehrkrankenhäusern sein werden, sondern an der Front», komme auf das zivile Gesundheitssystem «eine erhebliche Belastung zu, denn zusätzlich ist mit erheblichen Flüchtlingsströmen zu rechnen und unsere eigene Bevölkerung muss ja auch noch versorgt werden», schrieb Oberst-Arzt Professor Benedikt Friemert vom Bundeswehrkrankenhaus am Oberen Eselsberg in Ulm. Sein Ziel: «Chirurgen für das Thema der Landes- und Bündnisverteidigung zu sensibilisieren.»
Friemerts Artikel vom September 2024 ist nur ein Beispiel, wie die – aus Sicht der Regierung noch fehlende – «Kriegstüchtigkeit» zunehmend zivile Gesundheitseinrichtungen in Deutschland durchdringt.
1000 bis 2000 Verwundete pro Tag
Im Oktober 2024 veranstaltete die deutsche Bundesärztekammer die Tagung «Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten».
Im November 2024 prangte auf dem Cover des «Hessischen Ärzteblatts» ein Foto des gepanzerten Mehrzweckfahrzeugs Yak der Bundeswehr. Es bezog sich auf einen Artikel über «gelebte zivil-militärische Zusammenarbeit». Dieser berichtete vom Ärzte-Symposium «Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?» in der wohl «schönsten Kaserne Deutschlands», Schloss Oranienstein.
Dieser Bericht nannte sogar noch höhere Opferzahlen. Die Leser erfuhren: «Deutschland werde Ziel militärischer Angriffe sein. […] In einem Worst-Case-Szenario sei durchaus mit ein- bis zweitausend Verwundeten täglich zu rechnen, die zunächst in den Krankenhäusern Deutschlands behandelt werden müssten.»
Feldgeistliche als Beistand
Im «Deutschen Ärzteblatt» finden sich Dutzende von Artikeln zum Thema, mit Schlagzeilen wie «Berliner Krankenhäuser bereiten sich auf Kriegsfall vor» oder «Kritische Infrastruktur: Es muss jetzt schnell gehen». Jüngst veröffentlichte es eine Reportage über eine Übung des Sanitätsdienstes, inklusive «seelsorgerische Begleitung von Verwundeten ohne Überlebenschance». Der Text komme daher wie eine «detaillierte Werbeschrift mit Verherrlichung der technischen/digitalen Lösungen» aus der Pressestelle der Bundeswehr, kritisierte ein Leser.
Das System sei auf Krisen- und Katastrophenfälle «bis hin zu Kriegsfällen» unzureichend vorbereitet. Darauf wiesen deutsche Berufsverbände für Narkose- und Intensivmedizin Mitte September im «Deutschen Ärzteblatt» hin. Es brauche Geld und «dringend eine digitale Echtzeiterfassung aller Krankenhauskapazitäten, damit eine bundesweite Steuerung von Intensiv- und Normalstationen möglich wird. Dazu gehöre die Erfassung freier Normal- und Intensivbetten, aber auch von Beatmungsplätzen, Isolationskapazitäten und der Personalsituation vor Ort.»

Der Bergungspanzer auf dem Titelbild. © Lukas Reus, «Hessisches Ärzteblatt» 11/2024
Ukraine: Eine Großstadt voller amputierter Menschen
Zu rechnen sei mit vielen Schuss- und Explosionsverletzungen. Sie «gehen immer einher mit der schweren Kontamination des Wundgewebes durch Splitter oder eingetragene Uniformreste», erfuhren die Leserinnen und Leser des «Hessischen Ärzteblatts».
Auch Amputationen sind dann die Regel. Oberst-Arzt Friemert bezog sich auf die Erfahrungen in der Ukraine: Aktuell müssten dort circa 100’000 Amputierte behandelt werden. «Dabei ist auch eine nicht unerhebliche Zahl an mehrfachamputierten Patienten.» Solche Patienten würden einen «sehr guten Stumpf» benötigen, um dort eine «Prothese, die erhebliche Kosten verursacht», anpassen zu können.
«Im Vergleich zu den Verletzungen, die durch Terrorattentate entstehen, zeigen diese klassischen Kriegsverletzungen, gerade bei den Explosionsverletzungen, eine deutlich größere Gewebezerstörung. Dieses liegt daran, dass die industriell hergestellten Explosivwaffen wie Minen, Bomben und Granaten eine erheblich größere Energie freisetzen», klärte der Artikel von Benedikt Friemert in «Passion Chirurgie» auf.
Die Allgemeinärztin Ute Rippel-Lau gab in ihrem Artikel in «Wissenschaft und Frieden» zu bedenken: «In Kriegszeiten bekommt die Triage eine ganz andere Bedeutung. Geraten medizinische Ethik und militärische Logik in Konflikt, so ist das Militärische entscheidend. Nach dem Prinzip der ‹umgekehrten Triage› hätte dann das gering verletzte militärische Personal Vorrang gegenüber den Schwerverletzten oder den Zivilist*innen, denn nach kurzer Behandlung könnten diese Soldatinnen und Soldaten wieder militärisch eingesetzt werden. Letztendlich ginge es im Krieg in erster Linie um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr» und um die «Kriegsverwendungsfähigkeit» der Soldaten.
Bei der Behandlung an den Wiederaufbau denken
Bei der Versorgung der Verletzten sollte man auch an den Wiederaufbau nach dem Krieg denken: «Je besser es uns gelingt, die körperliche Integrität und Funktionalität wiederherzustellen, desto leichter wird uns gemeinsam der Wiederaufbau gelingen», so Friemert.
Seinen zivilen Kollegen riet der Oberst-Arzt, «einen gewissen Mut [zu] haben, auch außerhalb der eigenen Komfortzone Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet zum Beispiel, als Gynäkologe vielleicht eine Bauchblutung zu stillen oder als Plastischer Chirurg eine Gefäßverletzung zu versorgen».
Bereits in Spuren tödlich
Der Präsident des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe setzte die Ärzteschaft ins Bild, dass «großflächige CBRN-Lagen» möglich seien. Die Abkürzung steht für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren.
Bei extrem giftigen Substanzen wie «VX» genügen kleinste Mengen, um den Tod herbeizuführen, erfuhr die Leserschaft des «Hessischen Ärzteblatts». Das betreffe mindestens indirekt auch Mitarbeitende im Gesundheitswesen: «Beim Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn 1995 durch die Aum-Sekte mit dem Nervengift Sarin seien 25 Prozent des Klinikpersonals behandlungsbedürftig geworden.

Kampfstoff VX: Diese winzige Menge (Kreis) genügt um einen Menschen zu töten. © Lukas Reus, «Hessisches Ärzteblatt» 11/2024
Über eine Million auf der Flucht
Bis zu zwei Prozent der Bevölkerung – das sind in Deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen – müssten als Geflüchtete aufgenommen werden. Solche Szenarien seien eine «extreme Herausforderung» für das Gesundheitswesen». Es sei zudem damit zu rechnen, dass zivile Spitäler zur Zielscheibe von Sabotage und Anschlägen werden, so der Präsident des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der bei der Bundesärztekammer referierte.
Durch Sabotage oder bei einem direkten Angriff verletzte Menschen haben häufig zusätzlich Verbrennungen. In ganz Deutschland gibt es aber nur «knapp über 100 Betten in den Verbrennungszentren».
Das Wort «Atomkrieg» wird vermieden
Erwähnt wurde im «Hessischen Ärzteblatt» auch die Ausbildungsmöglichkeit zur «medizinischen Dekontaminationsfachkraft». Die Teilnehmenden würden den Umgang mit radioaktiver Strahlung erlernen nach dem Motto «Die Angst verlieren und den Respekt behalten.»
«Das Wort ‹Atomkrieg› wird in fast allen Zivilschutzpapieren vermieden. Stattdessen ist von ‹größeren radioaktiven Zwischenfällen› oder ‹CBRN-Lagen› die Rede», schrieb Ute Rippel-Lau in der Zeitschrift «Wissenschaft und Frieden». Rippel-Lau ist Mitglied von IPPNW, der Vereinigung «Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges – Ärzt*innen in sozialer Verantwortung». Die IPPNW erhielt 1985 den Friedensnobelpreis. Aus Sicht der IPPNW werde derzeit «die Illusion erzeugt, in einem Atomkrieg sei medizinische Hilfe möglich. Auch wenn Katastrophenübungen dies glauben machen sollen: Es gibt keine sinnvolle medizinische Vorbereitung auf einen Atomkrieg.»
«Kriegsprävention wird nicht mehr als Ziel benannt»
Die Flut von Verletzten halte möglicherweise über Jahre an, ergänzte ihr Artikel in «Wissenschaft und Frieden». Rippel-Lau weist dort darauf hin: «Uns fehlt medizinisches Personal schon in Friedenszeiten.»
Das weiß auch die deutsche Regierung. Sie plant daher ein «Gesundheitssicherstellungsgesetz». Rippel-Lau warnt vor derartigen «Schubladengesetzen», die «nach Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalles» mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Parlaments «entsperrt» werden könnten. Dann können Grundrechte außer Kraft gesetzt und Personen zur Arbeit im Gesundheitswesen gezwungen werden, falls es nicht genügend Freiwillige gibt.
Die bayrische Gesundheitsministerin forderte im Juni im «Deutschen Ärzteblatt», dass sich «auch Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken […] und Therapeuten für die anstehenden Aufgaben aufstellen» müssten. Doch es gebe «‹noch nicht einmal eine Gedankenskizze› zur Einbindung ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte sowie anderer Fachkräfte im Ernstfall», kritisierte ein anderer Beitrag.
Bereits im Sommer 2024 verabschiedete das deutsche Parlament die neuen «Rahmenrichtlinien Gesamtverteidigung». Während in der vorangegangenen Fassung von 1989 «Kriegsverhütung, Entspannung, Dialog, gemeinsame Sicherheit und Abrüstung noch im Fokus standen, dominiert in den neuen Rahmenrichtlinien die ‹Kriegsertüchtigung›», so Rippel-Lau. «Kriegsprävention wird nicht mehr als Ziel benannt.»